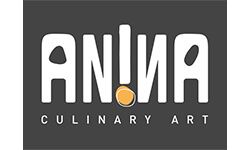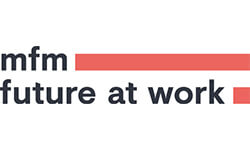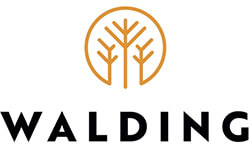Willkommen beim Global Food Summit
In Collaboration With:

Die Zukunft wartet nicht
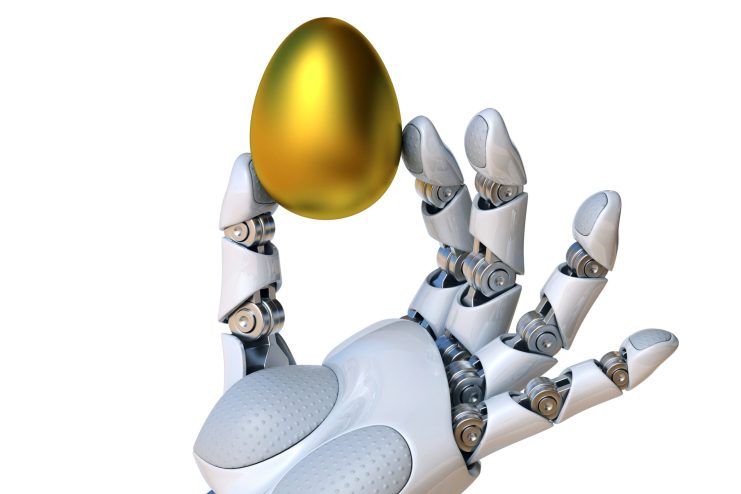
Global Food Summit 2025
Enhance Novel Food Technologies

GLOBAL FOOD SUMMIT MEDIA
Research, Position, Decide

SCI-Cress 2024 – Expert-Talks
Share Your Knowledge Globally

Newsletter
Broaden the Horizon

Consulting Services
Connect, Contact, Convince

Partner werden
Contributing to sustainable solutions